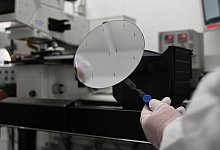Lars Klingbeil hat mindestens zwei Probleme: Die von ihm geführten Sozialdemokraten kommen einfach nicht aus dem Umfragetief heraus und dümpeln weiter um die 15 Prozent herum. Und in seiner Funktion als Bundesfinanzminister steht er vor einem gewaltigen Haushaltsloch. Zwischen 2027 und 2029 fehlen in der Finanzplanung mehr als 170 Milliarden Euro, allein 2027 sind es rund 34 Milliarden Euro. Nun hofft der SPD-Mann, beide Probleme in einem Aufwasch lösen zu können: Er folgt dem linken Reflex, bei Haushaltslöchern nach Steuererhöhungen zu rufen.
Erwartungsgemäß blockt die Union ab und kann sich dabei auf den Koalitionsvertrag berufen, der keine höheren, sondern im Gegenteil niedrigere Steuern verspricht. Klingbeil macht es sich zu einfach, aber zumindest in einem Punkt hat er recht: Das deutsche Steuersystem ist extrem ungerecht, insbesondere die Einkommensteuer: Wurde 1965 der Spitzensteuersatz beim 15-Fachen des Durchschnittslohnes fällig, liegt die Grenze heute nur noch beim 1,5-Fachen. Ein gut verdienender Facharbeiter zahlt in der Spitze also genauso viel an den Fiskus wie ein Manager mit einem Jahreseinkommen von 250.000 Euro.
Außerdem ist der Verlauf des Steuertarifs inzwischen sehr steil. Das führt dazu, dass die Belastung gerade im unteren und mittleren Einkommensbereich besonders stark mit dem Einkommen ansteigt. Mit dem Grundsatz einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit hat das nichts mehr zu tun.
So sähe eine runde Steuerreform aus
Die Spitzenbelastung muss deutlich später einsetzen, die Kurve abgeflacht werden. Das kostet allerdings Milliardenbeträge. Die können aber wieder reingeholt werden, wenn gleichzeitig der Spitzensteuersatz, der heute lediglich bei 42 Prozent liegt, angehoben wird. Nur zur Erinnerung: Jahrzehntelang lag der Spitzensatz in der alten Bundesrepublik bei 53 Prozent, zeitweise sogar bei 56 Prozent. Auch unter unionsgeführten Bundesregierungen wurde das als gerecht empfunden.
Das wäre eine runde Steuerreform, für die Klingbeil auch in der Union eine Zustimmung erreichen könnte. Schließlich hat Friedrich Merz in der vergangenen Wahlperiode als Oppositionsführer mehrfach anklingen lassen, dass er Steuererhöhungen in Kauf nehmen würde, wenn dadurch die Mittelschicht entlastet würde.
Diese Steuersubventionen sind unsinnig
Eine derartige Steuerreform, die sich durch eine Umverteilung von reich zu arm weitgehend selbst finanziert, löst jedoch die Haushaltsprobleme nicht. Es gibt aber genügend Steuersubventionen, die abgeschafft werden können, weil sie gänzlich ohne die erhoffte Lenkungswirkung geblieben oder sogar kontraproduktiv sind: Der Bundesrechnungshof plädiert beispielsweise dafür, die Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen in privaten Haushalten und das Dieselprivileg – also die gegenüber Benzin niedrigere Besteuerung von Diesel – zu streichen, Flugbenzin zu besteuern und den Katalog des ermäßigten Umsatzsteuersatzes deutlich zu straffen.
Allein durch den Wegfall zweifelhafter Vergünstigungen ließen sich die Haushaltslöcher stopfen. Nebenbei würde auch noch die Steuergerechtigkeit steigen, schließlich profitieren von Subventionen immer nur einzelne Gruppen und nicht die Masse der Steuerzahler.

Mit Sticheleien wird Klingbeil die Probleme nicht lösen
Beginnen müsste die Koalition allerdings damit, den von der CSU in den Koalitionsvertrag hineinverhandelten ermäßigten Steuersatz für Restaurants wieder abzusagen – zumal die Branche schon klargemacht hat, dass sie die niedrigen Preise nicht weitergeben, sondern damit die Gewinne steigern will.
Klingbeil aber fehlt derzeit die Kraft, das und andere Einschnitte durchzusetzen. Für einen Finanzminister ist das dramatisch. Mit Sticheleien gegen den Koalitionspartner wird er seine enormen Haushaltsprobleme jedenfalls nicht lösen.