
Halle. Alles beginnt 1903 mit einem Kessel und drei Arbeitern. Und zwar nicht in Halle, wo heute ein Weltkonzern seinen Sitz hat, sondern in Werther: Hier gründet August Storck – genannt Oberwelland – die »Werthersche Zuckerwarenfabrik«. Das Unternehmen wächst schnell, liefert im gesamten westfälischen Raum aus – bis der Erste Weltkrieg die Erfolgsgeschichte zunächst jäh unterbricht.
1934 beginnt die Geschichte der Marken bei Storck – es ist Hugo Oberwelland, Sohn des Gründers, der die »Storck 1 Pfennig RIESEN« erfindet. Sie verdrängen die bis dahin namenlosen Klümpchen. Es soll trotz stetigen Wachstums des Unternehmens bis nach dem Zweiten Weltkrieg dauern, ehe die zweite Marke die Storck-Familie bereichert: 1953 erscheint »Mamba« auf der Bildfläche.
"nimm2" ist jahrelang das meistverkaufte Bonbon Deutschlands
Die 1960er-Jahre markieren ein goldenes Zeitalter der Innovation bei Storck. Diese Erfolge sind eng mit dem Namen Dr. Geert Andersen verbunden. 1955 wirbt Hugo Oberwelland ihn als Forschungs- und Labordirektor von Bayer ab – unter seiner Regie entstehen Marken wie Merci, Toffifee oder Werther’s Echte – das Bonbon baut mit seinem Namen die Brücke zum Gründungsort des Unternehmens. Die Entwicklung von »nimm2« (1962) gilt allerdings bis heute als Andersens größter Coup, weil er es schafft, empfindliche Vitamine in eine heiße Bonbonmasse einzuarbeiten. Jahrelang ist »nimm2« daraufhin Deutschlands meistverkauftes Bonbon. Merci (1965), Campino (1966) und Werther’s Echte (1969) (heute: Werther’ s Original) mehren Storcks Markenruhm darüber hinaus – das Unternehmen wächst weiter und baut einen zweiten Produktionsstandort in Berlin auf.
Zu Beginn des neuen Jahrzehnts übernimmt Klaus Oberwelland 1971 die Verantwortung bei Storck. Die 1970er-Jahre sind geprägt von der Toffifee-Einführung (1973). Mit der nächsten Schokoladenspezialität stellt sich der Haller Süßwarenhersteller noch breiter auf und macht sich vor allem zukunftssicher. Denn während andere Unternehmen in Wohl und Wehe mitunter von einem Produkt abhängig sind, kann Storck auf zahlreiche starke Marken und Produktfamilien bauen. Das ist letztlich auch dem konsequenten Einsatz von Werbemaßnahmen zu verdanken, der sich als grundlegende Strategie durch die Unternehmensgeschichte zieht.
Knoppers als Nussriegel ist ein weiterer Coup für Storck
Und der Innovationshunger des Süßwarenriesens ist noch lange nicht gestillt: 1983 kommt »Knoppers« auf dem Markt, vom Unternehmen als „Milch-Haselnuss-Schnitte" bezeichnet, 1985 folgt der Schaumkuss »Dickmann’s«. All die Produkte müssen für den Weltmarkt produziert werden – 1993 expandiert Storck mit einem Werk in Ohrdruf (Thüringen). Herz und Ideenschmiede das Konzerns bleibt allerdings Halle. Hier kochen die meisten Kessel, hier wächst nach und nach »die Fabrik im Grünen« heran. Und mit »Knoppers« als Nussriegel gelingt auch Axel Oberwelland (Chef seit 2003) in vierter Generation ein echter Markencoup. Gut 6.000 Mitarbeiter, ein geschätzter Jahresumsatz von 2,7 Milliarden Euro und Werbemaßnahmen von rund 130 Millionen Euro jährlich – Storcks starke Marken haben eine Erfolgsgeschichte geschaffen. Weitere Kapitel sind bestimmt in Planung.

Es war die erste Etappe auf dem Weg zu einer in dieser Form sicherlich einzigartigen Verknüpfung von Marke und Sport. 1993 wird die Tennisarena Gerry Weber Stadion eröffnet, verbunden mit dem Startschuss für das Profiturnier Gerry Weber Open. Die Modemarke wird mit Spitzensport assoziiert, es ist der Beginn eines Siegeszuges für den Konzern. Der ist nun vorerst beendet – und mit ihm vielleicht auch die namentliche Verbindung zu Turnier und Stadion.

Das 1935 gegründete Unternehmen hat mittlerweile einen Jahresumsatz von rund zwei Milliarden Euro vorzuweisen, rund 7.000 Fahrzeuge und etwa 12.000 Mitarbeiter an mehr als 130 eigenen Standorten ermöglichen ein imposantes Logistiknetzwerk. Nagel ist in der Lage, mehr als 100.000 Sendungen täglich zu befördern.
Und wie so manche Erfolgsgeschichte begann auch diese ganz klein: Am 22. Mai 1935 gründeten Kurt und Rudolf Nagel die Spedition »Gebrüder Nagel«. Erstes Fahrzeug der Jungunternehmer: Ein 10-Tonnen-Lastzug der Marke Büssing. Nur wenige Monate später ersetzten sie das Fahrzeug durch einen 18-Tonner. Im darauf folgenden Jahr ergänzten die Brüder ihren Fuhrpark um einen gebrauchten MAN-Elftonner. Doch der Zweite Weltkrieg warf das junge Unternehmen weit zurück – mit nur einem Laster ging es 1945 wieder von vorn los.
Der Gewinn des Medienkonzerns Bertelsmann als Kunde im Jahr 1958 war sicherlich ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte, die fortan unaufhaltsam an Fahrt aufnahm. Niederlassung um Niederlassung wurde eröffnet und verdichtete das Nagel-Netzwerk, für das seit 1984 Kurt Nagel junior verantwortlich zeichnete. Mitte der 1990er-Jahre wagt Nagel die europäische Expansion nach Großbritannien und Skandinavien, es werden Gesellschaften in Italien und Österreich gegründet. Die Spedition wächst eben mit ihren erfolgreichen Kunden, erobert sich aber auch selbst zunehmend neue Märkte und Regionen.
Der überraschende Tod von Kurt Nagel junior mit nur 46 Jahren 2008 ist ein schwerer Schlag für den Familienkonzern. Seinen Expansionskurs führen die Verantwortlichen indes fort. Der blaue Nagel-Schriftzug soll also weiter ein vertrauter Blickfang auf den Autobahnen bleiben.


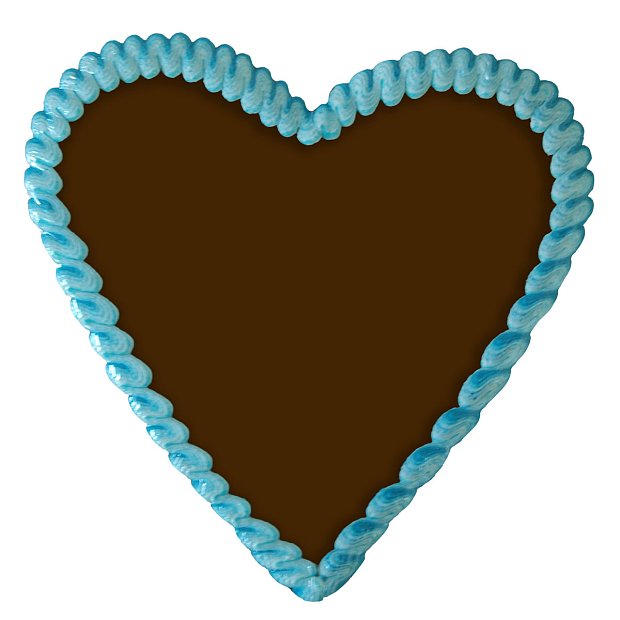


Denn als Johann Anton Kisker aus Spenge 1732 die Haller Bürgermeistertochter Anna Maria Brune heiratete, übernahm er das Leinengeschäft – das spätere Kiskerhaus. Es entwickelte sich zum Handelshaus, zu dessen Gütern schnell auch Branntwein und Tabak zählten. Der Grundstein war gelegt.
Von 1810 bis 1813 verlief die Grenze zwischen dem Kaiserreich Frankreich und dem Königreich Westfalen mitten durch Halle, was kluge Kaufleute wie Wilhelm Kisker in der dritten Generation wirtschaftlich zu nutzen wussten. Er wandelte den Unternehmenszweck vom Handel zur eigenen Produktion und modernisierte die Branntweindestillation.
Eduard Kisker trat 1878 in die Firma ein und entwickelte die industrielle Fabrikation weiter. 1884 und 1904 baute er zwei Brennereien. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten Wilken Christoph Kisker und Herbert Kisker den Betrieb neu aufbauen. In den Jahren 1978 und 1979 forcierte Cornelius Kisker Planung und Bau des neuen Betriebes in Künsebeck.
Dort werden heute auf 17.000 Quadratmetern Fläche jährlich vier Millionen Flaschen produziert. Was sich aus Leinen so entwickelt ...

